Kurzfassung
In dieser Folge gehen Birte und Gorden der Frage nach, wo ADHS eigentlich herkommt – und räumen dabei mit vielen Missverständnissen auf. Sie sprechen darüber, warum Genetik der stärkste Einflussfaktor ist, wie das Gehirn von Menschen mit ADHS arbeitet und welche Rolle Umwelt, Erziehung und Stress tatsächlich spielen. Dabei wird klar: ADHS ist keine neue Erscheinung und ganz sicher nicht das Ergebnis „falscher Erziehung“, sondern ein Zusammenspiel aus biologischen Grundlagen und individuellen Erfahrungen.
Weitere Infos, Kontaktmöglichkeiten und Unterstützung findet ihr unter adhsneudenken.de.
Themen
- Was ADHS verursacht – und was nicht
- Warum Genetik der größte Einflussfaktor ist
- Neurobiologische Grundlagen: Dopamin, Noradrenalin & Exekutivfunktionen
- Umweltfaktoren und Epigenetik – Verstärker, aber keine Ursachen
- Alltagsfaktoren wie Routinen, Energiehaushalt und Reizoffenheit
- Wie man die eigenen Nachteile besser managen kann
- Warum es wichtig ist, neben Herausforderungen auch über Stärken zu sprechen
Langfassung
In dieser Episode widmen sich Birte und Gorden einem der zentralsten, aber am häufigsten missverstandenen Themen rund um ADHS: den Ursachen. Noch immer glauben viele Menschen, ADHS sei das Ergebnis schlechter Erziehung, zu viel Bildschirmzeit oder mangelnder Disziplin. Die beiden machen deutlich, warum diese Annahmen wissenschaftlich nicht haltbar sind.
Sie erklären, dass ADHS in erster Linie eine neurobiologische und genetische Besonderheit ist. Studien zeigen, dass die Vererbbarkeit bei 70–80 % liegt – ein extrem hoher Wert, der unterstreicht, dass ADHS tief in der Biologie verwurzelt ist. Birte und Gorden sprechen darüber, wie das Zusammenspiel von Dopamin, Noradrenalin und Exekutivfunktionen das Verhalten und die Wahrnehmung von Menschen mit ADHS prägt und warum viele alltägliche Herausforderungen direkt aus dieser neurologischen Architektur entstehen.
Darüber hinaus beleuchten sie sogenannte „Umweltfaktoren“ – Stress, soziale Dynamiken, Mediennutzung, Ernährung oder Schlaf –, erklären aber klar, dass diese Faktoren vor allem verstärkend wirken und ADHS nicht verursachen. Wichtig sei vor allem zu verstehen, wie epigenetische Prozesse funktionieren: Die Gene verändern sich nicht, aber ihre Aktivität kann in bestimmten Kontexten beeinflusst werden.
Im weiteren Verlauf sprechen die beiden darüber, wie Menschen mit ADHS im Alltag besser zurechtkommen können. Routinen, ein bewusster Umgang mit Energie, Reizmanagement und das Verständnis der eigenen Bedürfnisse spielen eine große Rolle. Sie diskutieren, warum manche Methoden bei ADHS gut funktionieren – und andere eben nicht.
Außerdem wird deutlich, dass der gesellschaftliche Blick auf ADHS häufig zu negativ ist. Birte und Gorden betonen, dass ADHS zwar Herausforderungen mit sich bringt, aber auch besondere Stärken – wie Kreativität, Hyperfokus, Problemlösungskompetenz und emotionale Tiefe. Diese Stärken entfalten sich allerdings erst richtig, wenn Menschen ihren Alltag so gestalten können, dass er zu ihrer individuellen Funktionsweise passt.
Die Folge bietet einen wissenschaftlich fundierten, aber gleichzeitig praxisnahen Überblick, der hilft, ADHS besser zu verstehen und sowohl die Schwierigkeiten als auch die Potenziale zu erkennen.
Takeaways
- ADHS ist primär genetisch und neurobiologisch bedingt – nicht „hausgemacht“
- Umweltfaktoren verstärken Symptome, verursachen sie aber nicht
- Ein Verständnis für den eigenen Energiehaushalt kann den Alltag enorm erleichtern
- Routinen, Struktur und Reizmanagement helfen, Nachteile abzufedern
- Hyperfokus, Kreativität und schnelle Problemlösung sind echte Stärken vieler ADHS-Betroffenen
- Ein ausgewogener Blick auf Herausforderungen und Potenziale verändert das Selbstbild positiv
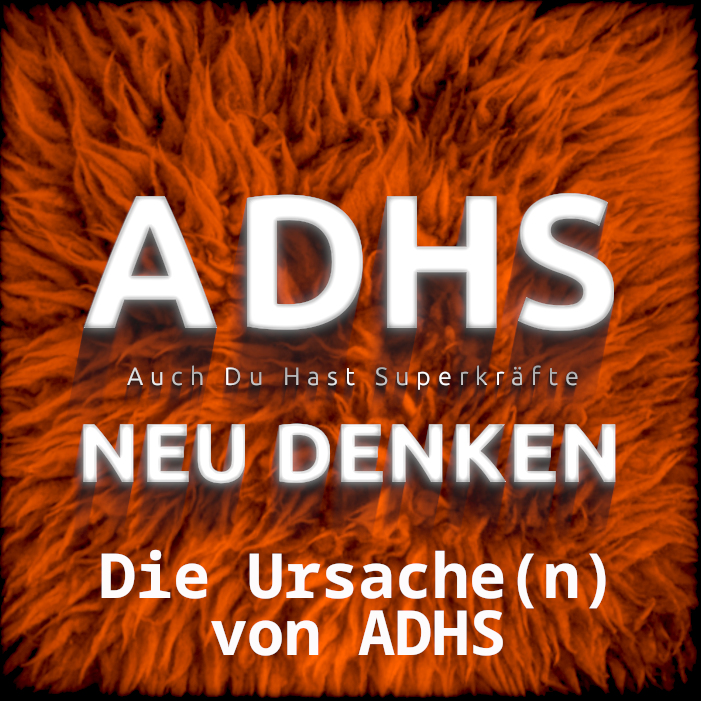
Schreibe einen Kommentar